Diagnoodle Blog Home > Gerinnung > Fibrinogen
Fibrinogen (auch Faktor I der Blutgerinnung genannt) ist ein lösliches Glykoprotein, das in der Leber gebildet wird. Bei einer Gefäßverletzung wird es durch das Enzym Thrombin in Fibrin umgewandelt. Fibrin bildet zusammen mit Thrombozyten (Blutplättchen) das Grundgerüst eines stabilen Blutgerinnsels.
Im Unterschied zu anderen Gerinnungsparametern wie der International Normalized Ratio (INR), die vor allem die Gerinnungszeit bei Vitamin-K-Mangel oder Antikoagulation beschreibt oder den D-Dimeren, die auf einen gesteigerten Abbau von Fibrin hindeuten, ist Fibrinogen ein Marker für die Bildung von Fibrin. Es steht damit am Beginn der Gerinnungskaskade und ist gleichzeitig ein wichtiger Akute-Phase-Parameter, der bei Entzündungen ansteigt.
In unserem Hauptartikel finden Sie einen Gesamtüberblick zum Thema Blutgerinnung: Moderne Tests, Therapie & Trends.
Fibrinogen ist nicht nur für die Blutstillung von Bedeutung, sondern spielt auch in anderen physiologischen Prozessen eine Rolle. Als Akute-Phase-Protein steigt es bei Entzündungen, Infektionen, Operationen oder Traumata an. Dieser Anstieg ist Teil der körpereigenen Abwehrreaktion und beeinflusst unter anderem die Blutviskosität.
Darüber hinaus wirkt Fibrinogen auf die Gefäßwand, indem es mit Rezeptoren von Endothelzellen interagiert. Es ist damit nicht nur Marker, sondern aktiver Mitspieler im Entzündungsgeschehen und bei der Atherosklerose (Zhang et al., 2025).
Die Referenzwerte für Fibrinogen liegen im Blutplasma bei Erwachsenen in der Regel zwischen 200 und 400 mg/dl. Abweichungen von diesem Bereich können ein Hinweis auf eine Gerinnungsstörung sein.
| Parameter | Normwert | Besonderheiten |
|---|---|---|
| Fibrinogen (Plasma) | 200–400 mg/dl | Schwangerschaft: bis 600 mg/dl |
| Kritischer Wert | <100 mg/dl | Blutungsgefahr |
| Kritischer Wert | >700 mg/dl | erhöhtes Thromboserisiko |
Die Bestimmung erfolgt im Labor meist nach der Clauss-Methode, einer gerinnungsbasierten Messung. Moderne Systeme erlauben heute zusätzlich die Bestimmung am Point of Care (POCT). Diese liefert Ergebnisse innerhalb weniger Minuten direkt am Patientenbett, was insbesondere auf Intensivstationen und im OP von Vorteil ist.
Ein erhöhtes Fibrinogen kann verschiedene Ursachen haben. Häufig liegt eine unspezifische Entzündungsreaktion vor, zum Beispiel bei Infektionen, rheumatischen Erkrankungen oder malignen Tumoren. Auch während der Schwangerschaft und bei Raucher:innen ist der Fibrinogenwert oft erhöht.
Medizinisch relevant ist ein erhöhter Wert vor allem wegen seines Zusammenhangs mit kardiovaskulären Erkrankungen. Studien zeigen, dass hohe Fibrinogenkonzentrationen das Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall steigern. Eine aktuelle Untersuchung bestätigte zudem den Zusammenhang: Xu et al. (2025) konnten zeigen, dass höhere Fibrinogenspiegel signifikant mit einem erhöhten Risiko für akuten Myokardinfarkt assoziiert sind. Fibrinogen gilt daher als unabhängiger Risikofaktor für Atherothrombosen.
Kurzfristige Anstiege sind dagegen oft harmlos und spiegeln eine akute Stressreaktion wider. Entscheidend ist die klinische Einordnung.
Ein isoliert hoher Fibrinogenwert verursacht keine direkten Symptome. Die Gefahren liegen in den Folgeerkrankungen: Durch die erhöhte Viskosität des Blutes steigt die Thromboseneigung, was wiederum Gefäßverschlüsse begünstigt. In einer prospektiven Studie zeigte sich, dass erhöhte Fibrinogenwerte mit veränderten Gerinnungseigenschaften und einem deutlich gesteigerten Risiko für venöse thromboembolische Ereignisse assoziiert waren (Idling et al, 2024).
Symptomatisch werden Patient:innen deshalb meist erst durch die Folgen: Beinvenenthrombose mit Schwellung und Schmerzen, Lungenembolie mit akuter Dyspnoe oder Herzinfarkt und Schlaganfall bei arteriellen Verschlüssen. Die Behandlung richtet sich nicht gegen den Fibrinogenwert an sich, sondern gegen die Grunderkrankung oder die Prävention thromboembolischer Ereignisse.
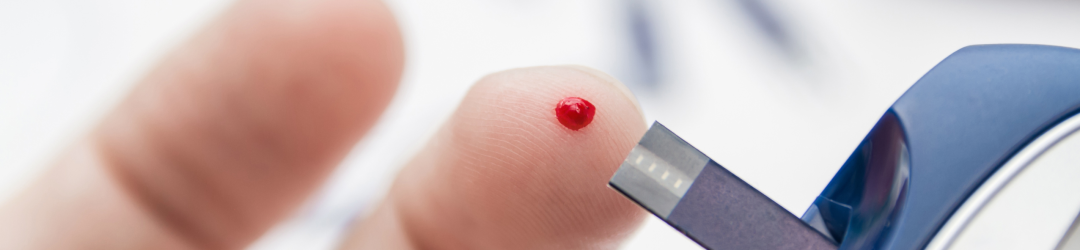
Ein zu niedriges Fibrinogen ist klinisch meist gefährlicher als ein erhöhter Wert. Ursachen sind:
Verbrauchskoagulopathie (disseminierte intravasale Gerinnung, DIC) bei Sepsis oder Schock
Lebererkrankungen, da die Synthese vermindert ist
Massive Blutungen mit Verdünnungseffekt nach Transfusion
Angeborene Hypo- oder Afibrinogenämie (selten)
Die Folgen sind spontane Blutungen oder verlängerte Blutungszeiten nach Operationen und Verletzungen. Bereits Werte unter 150 mg/dl können das Blutungsrisiko deutlich erhöhen. Eine Studie zeigt, dass niedrige Fibrinogenspiegel eng mit erhöhter Blutungsneigung und schlechtem klinischem Outcome verbunden sind (Leal-Noval & Rincon, 2025).
Fibrinogenwerte spielen in zahlreichen klinischen Situationen eine bedeutende Rolle. Bei einer Sepsis sinkt die Konzentration im Verlauf häufig deutlich ab, was nicht nur auf die Schwere der Erkrankung hinweist, sondern auch prognostische Aussagen erlaubt. Eine aktuelle Analyse zeigte, dass niedrige Fibrinogenspiegel bei kritisch erkrankten Patient:innen signifikant mit einer erhöhten Intensivstationsmortalität verbunden sind (Ren et al, 2025). Im Kontext von Traumata oder großen chirurgischen Eingriffen ist eine rasche Kontrolle der Gerinnungssituation entscheidend, wobei der Fibrinogenspiegel ein zentraler Parameter ist.
Darüber hinaus gilt in der Kardiologie ein erhöhter Wert als unabhängiger Risikofaktor für koronare Ereignisse wie Herzinfarkt oder Schlaganfall. Auch in der Onkologie haben erhöhte Fibrinogenwerte klinische Relevanz, da sie bei verschiedenen Tumorerkrankungen auftreten und teilweise mit der Prognose verknüpft sind. Auf diese Weise ergänzt Fibrinogen die klassischen Gerinnungsparameter wie die Prothrombinzeit oder die D-Dimere und liefert zusätzliche pathophysiologische Informationen.
Traditionell wird Fibrinogen im Labor bestimmt, was in der Regel 30 bis 60 Minuten dauert. In akuten Situationen wie Polytrauma, kardiochirurgischen Eingriffen oder massiven Blutungen kann diese Zeit entscheidend sein.
Hier bieten Point-of-Care-Geräte klare Vorteile. Kompakte Systeme wie das OCG-102 von Wondfo, das SD1 von Seamaty sowie das qLabs FIB von Micropoint sind speziell auf die schnelle Fibrinogenbestimmung ausgerichtet. Darüber hinaus stehen auch Tests für aPTT, Thrombozyten und die Activated Clotting Time (ACT) zur Verfügung, sodass unterschiedliche Aspekte der Gerinnung am Patientenbett erfasst werden können. Die Point-of-Care-Systeme sind klein, mobil einsetzbar und liefern Ergebnisse in wenigen Minuten, was insbesondere in der Notfallmedizin, in kleineren Kliniken oder im niedergelassenen Bereich von großer Bedeutung ist.
Darüber hinaus existieren umfassendere Verfahren der Viskoelastometrie, wie die Rotationsthromboelastometrie (ROTEM) oder die Thromboelastographie (TEG). Diese Systeme erfassen die Blutgerinnung in ihrer Gesamtheit – von der Aktivierung über die Stabilität bis zur Fibrinolyse – und erlauben durch spezielle Testmodi (z. B. FIBTEM) auch eine isolierte Beurteilung des Fibrinogens.
Die Ergebnisse aus Messungen am Point of Care ermöglichen eine gezielte Steuerung der Gerinnungstherapie, beispielsweise durch die zeitgerechte Gabe von Fibrinogenkonzentrat. Grenzen dieser Verfahren liegen in der Geräteverfügbarkeit, den Kosten und der notwendigen Schulung des Personals. Dennoch empfehlen aktuelle Leitlinien zunehmend den Einsatz im perioperativen Gerinnungsmanagement (Weber et al., 2023).
Fibrinogen steht im Zentrum der Gerinnungskaskade. Es wird durch Thrombin zu Fibrin umgewandelt und bildet damit das Grundgerüst des Blutgerinnsels. Gleichzeitig wirkt es als Akute-Phase-Protein und spiegelt entzündliche Prozesse wider. Erhöhte Werte kennzeichnen ein gesteigertes Risiko für Gefäßverschlüsse, erniedrigte Werte bedeuten ein akutes Blutungsrisiko. Damit nimmt Fibrinogen eine Doppelrolle ein: Es ist sowohl ein Schlüsselprotein der Blutstillung als auch ein Marker für systemische Erkrankungen.
Fibrinogen ist ein in der Leber gebildetes Eiweiß und Vorstufe von Fibrin. Es stabilisiert Blutgerinnsel und ist ein zentraler Faktor der Hämostase.
Bei Erwachsenen liegen die Normwerte zwischen 200 und 400 mg/dl. In der Schwangerschaft können Werte bis 600 mg/dl physiologisch sein.
Ein erhöhter Fibrinogenwert tritt bei akuten Entzündungen, Infektionen, Tumoren, Rauchen oder während der Schwangerschaft auf und gilt als Risikofaktor für Herzinfarkt und Schlaganfall.
Niedrige Werte deuten häufig auf Verbrauchskoagulopathie, schwere Lebererkrankungen oder massive Blutungen hin. Sie erhöhen das Risiko für unkontrollierte Blutungen erheblich.
Im Labor dauert die Analyse meist 30–60 Minuten. Am Point of Care ist eine Bestimmung innerhalb weniger Minuten möglich, was bei Blutungen oder Trauma entscheidend ist.
Die bereitgestellten Informationen sind ausschließlich für medizinisches Fachpersonal bestimmt. Sie dienen der neutralen, unabhängigen Information über Produkte und Studien im Bereich der In-vitro-Diagnostik. Eine individuelle Beratung oder Empfehlung erfolgt nicht. Alle Inhalte werden sorgfältig geprüft, dennoch übernehmen wir keine Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Die Nutzung erfolgt auf eigenes Risiko, jegliche Haftung ist ausgeschlossen.