Diagnoodle Blog Home > Polymerase Chain Reaction (PCR) > PCR in der modernen Medizin
Hinweis: Dieser Artikel richtet sich ausschließlich an medizinische Fachkreise.
PCR (deutsch: Polymerase-Kettenreaktion) ist eine der bedeutendsten Errungenschaften der modernen Medizin. Sie hat die Diagnostik von Infektionskrankheiten, genetischen Erkrankungen und Tumoren grundlegend verändert. Was zunächst als rein molekularbiologische Methode begann, ist heute ein unverzichtbares Werkzeug in Kliniken, Laboren und zunehmend auch in Praxen. Die PCR ermöglicht es, kleinste Mengen von Erbinformation zu vervielfältigen und so nachzuweisen, ob ein bestimmter Krankheitserreger oder ein genetischer Marker vorliegt. Für Ärzt:innen, medizinisches Personal und Klinik-Einkäufer:innen ist es entscheidend, die Möglichkeiten und Grenzen dieser Methode zu verstehen, da sie nicht nur diagnostische, sondern auch direkte therapeutische Konsequenzen hat.
Die PCR wurde in den 1980er-Jahren entwickelt und revolutionierte die Molekularbiologie (Mullis & Faloona, 1987). Sie beruht auf dem Prinzip, DNA (Desoxyribonukleinsäure) oder RNA (Ribonukleinsäure) gezielt zu vervielfältigen, bis sie messbar wird. Ein spezielles Enzym, die DNA-Polymerase, bildet dabei die Grundlage. Besonders bekannt ist die sogenannte Taq-Polymerase, die ursprünglich aus Bakterien in heißen Quellen isoliert wurde und daher sehr hitzestabil ist. Eine detaillierte Übersicht über Unterschiede, Vorteile und Grenzen finden Sie in unserem Blog-Artikel PCR-Testverfahren erklärt.
Der Ablauf besteht aus wiederholten Zyklen von drei Schritten:
Denaturierung: Durch Erhitzen werden die DNA-Doppelstränge in zwei Einzelstränge getrennt.
Annealing: Kurze DNA-Stücke, sogenannte Primer, binden an die Zielregion.
Elongation: Die DNA-Polymerase verlängert die Stränge, sodass neue Kopien entstehen.
Diese Schritte werden in einem Thermocycler 20 bis 40 Mal wiederholt. Durch die exponentielle Vervielfältigung reicht am Ende schon ein einzelnes DNA-Molekül aus, um zuverlässig nachgewiesen zu werden.
Die Polymerase-Kettenreaktion ist damit in der Lage, Erreger oder Mutationen selbst dann aufzuspüren, wenn sie nur in sehr geringer Konzentration im Probenmaterial vorhanden sind. Das macht sie zum Goldstandard der molekularen Diagnostik.
Neben der klassischen Polymerase-Kettenreaktion haben sich sogenannte isothermale Verfahren etabliert. Im Gegensatz zur PCR benötigen diese Methoden keinen Thermocycler, sondern arbeiten bei konstanter Temperatur. Das macht sie einfacher, schneller und praxistauglicher.
Wichtige Beispiele sind:
LAMP (Loop-mediated Isothermal Amplification): Diese Methode erlaubt die Amplifikation bei ca. 65 °C und liefert Ergebnisse oft schon innerhalb von 30 Minuten.
TMA (Transcription-Mediated Amplification): Besonders geeignet für RNA-Viren wie HIV oder Hepatitis, da die RNA direkt in DNA umgeschrieben und anschließend vervielfältigt wird.
NASBA (Nucleic Acid Sequence-Based Amplification): Ein Vorläuferverfahren, das ebenfalls vor allem für RNA eingesetzt wurde.
Ein direkter Vergleich verdeutlicht die Unterschiede:
| Verfahren | Temperaturführung | Dauer | Geräteaufwand | Typische Anwendung |
|---|---|---|---|---|
| PCR | Wechselnde Temperaturen (Thermocycler) |
1–3 Stunden | Hoch | Breite Diagnostik, Goldstandard |
| LAMP | Konstant ca. 65 °C | 30–60 Minuten | Niedrig | Point-of-Care, schnelle Infektionsdiagnostik |
| TMA | Konstant | 30–90 Minuten | Mittel | HIV, Hepatitis-Viruslast |
Isothermale Verfahren sind vor allem im Bereich der Point-of-Care-Testung interessant, da sie weniger Infrastruktur erfordern. Sie können die klassische PCR jedoch nicht vollständig ersetzen, da sie in Bezug auf Spezifität und regulatorische Absicherung noch nicht denselben Standard erreicht haben.
Die bekannteste Anwendung der PCR liegt in der Virusdiagnostik. Hier hat sie sich in den letzten Jahrzehnten als Standardmethode etabliert. Ein prägnantes Beispiel ist die SARS-CoV-2-Pandemie. Während Antigen-Tests schnell, aber weniger zuverlässig waren, blieb die RT-PCR (Reverse-Transkriptase-PCR) der Referenztest. So zeigte eine Studie von Smith-Jeffcoat et al. (2024), dass Antigen-Tests nur eine Sensitivität von etwa 47 % im Vergleich zu RT-PCR erreichen, das heißt: viele Infektionen, die per Polymerase-Kettenreaktion nachweisbar sind, würden mit einem Antigen-Test übersehen.
Darüber hinaus ist die PCR unverzichtbar bei der HIV-Diagnostik. Hier wird nicht nur das Vorhandensein des Virus nachgewiesen, sondern mittels quantitativer PCR (qPCR) auch die Viruslast bestimmt. Diese Werte sind Grundlage für die Therapieentscheidung und Verlaufsbeurteilung. Mehr zur frühen Diagnostik und sicheren Steuerung der Therapie erfahren Sie im Blog-Artikel HIV-PCR-Test: Früh erkennen & Therapie sicher steuern. Auch in der Hepatitis-Diagnostik wird die PCR eingesetzt, um Viruslasten zu bestimmen und den Erfolg antiviraler Therapien zu überwachen. Für Influenza wiederum bietet die PCR den Vorteil, A- und B-Viren sicher zu unterscheiden und so eine zielgerichtete antivirale Behandlung zu ermöglichen.
Gerade bei viralen Infektionen gilt: Je schneller ein Ergebnis vorliegt, desto früher kann eine spezifische Therapie eingeleitet oder eine unnötige Behandlung vermieden werden. In unserem Blog-Artikel PCR-Test im Überblick: Varianten, Zuverlässigkeit, Konsequenzen erfahren Sie mehr über die praktischen Einsatzmöglichkeiten in Klinik und Praxis.
Während Bakterien traditionell durch Kulturverfahren nachgewiesen werden, gewinnt die PCR auch hier an Bedeutung. Der Vorteil liegt in der Schnelligkeit und der Möglichkeit, Resistenzgene gezielt zu identifizieren. Ein aktuelles Beispiel liefert Duraiswamy et al. (2023): Sie entwickelten einen multiplexen TaqMan-PCR-Test zum direkten Nachweis von MRSA (Methicillin-resistentem Staphylococcus aureus) aus Vollblutproben und erreichten dabei hohe Spezifität und Sensitivität.
Ein Beispiel ist der Nachweis von MRSA. Hier erlaubt die PCR eine schnelle Entscheidung, ob eine Isolierung erforderlich ist, ohne tagelang auf ein Kulturergebnis warten zu müssen. Auch bei Mycobacterium tuberculosis wird die PCR eingesetzt, oft kombiniert mit Resistenztests, die bestimmen, ob ein Stamm gegenüber wichtigen Antibiotika unempfindlich ist. Weitere wichtige Anwendungen sind Clostridioides difficile in der Gastroenterologie oder Streptococcus pneumoniae in der Pneumonie-Diagnostik. Studien zeigen, dass PCR-basierte Tests die Isolationsdauer auf Intensivstationen verkürzen und die gezielte Antibiotikatherapie erleichtern
Ein weiteres großes Einsatzgebiet sind sexuell übertragbare Infektionen (STI). Hier ist die Polymerase-Kettenreaktion häufig die Methode der Wahl, da Kulturen aufwendig und nicht immer zuverlässig sind. Eine aktuelle Studie von Aguilera-Franco et al. (2024) evaluierte ein neues Real-Time-PCR-Kit, das gleichzeitig Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis und Mycoplasma genitalium nachweist, und zeigte eine Sensitivität von 99,53 % sowie eine Spezifität von 99,84 %. Dies unterstreicht die Zuverlässigkeit moderner PCR-Assays im STI-Bereich.
Besonders relevant ist der Nachweis von Chlamydia trachomatis, der häufigsten bakteriellen STI. PCR-Tests sind hier Standard und ermöglichen eine sichere Diagnose, auch wenn die Infektion asymptomatisch verläuft. Gleiches gilt für Neisseria gonorrhoeae, bei der Polymerase-Kettenreaktion nicht nur den Nachweis, sondern zunehmend auch die Resistenzbestimmung erlaubt. Auch bei HPV (Humanes Papillomavirus) ist die PCR zentral: Sie erlaubt die Identifikation von Hochrisiko-Typen, die für die Entstehung von Gebärmutterhalskrebs verantwortlich sind. In der Gynäkologie ist sie daher fester Bestandteil von Screening-Programmen. Nicht zuletzt spielt die PCR beim Nachweis von Herpes simplex Virus (HSV) eine Rolle, wenn unklare Läsionen abgeklärt werden müssen. Für niedergelassene Ärzt:innen ist gerade dieser Bereich relevant, da eine schnelle und sichere Diagnose die Therapieentscheidungen unmittelbar beeinflusst.
Neben Infektionskrankheiten ist die Polymerase-Kettenreaktion auch in der Onkologie von großer Bedeutung. Sie erlaubt es, genetische Veränderungen nachzuweisen, die das Tumorwachstum beeinflussen oder für zielgerichtete Therapien entscheidend sind. So demonstrierte die Studie von Rathor et al. (2024), dass ein „Plasma-First“-Ansatz mittels PCR-basierter Analyse von zellfreier Tumor-DNA (ctDNA) EGFR-Mutationen bei Lungenkarzinomen zuverlässig nachweist mit hoher Spezifität und verkürzter Bearbeitungszeit gegenüber herkömmlichen Gewebebiopsien. Wie die Echtzeitmessung funktioniert, erläutern wir im Blog-Artikel PCR Real-Time: Echtzeitdiagnostik für Klinik und Praxis.
Ein klassisches Beispiel ist die EGFR-Mutation beim Lungenkrebs. Nur wenn diese Mutation vorliegt, kann ein bestimmtes Medikament wirksam sein. Die PCR liefert hier die entscheidende Information. Gleiches gilt für KRAS-Mutationen beim Darmkrebs oder BCR-ABL-Translokationen bei Leukämien. Darüber hinaus wird PCR im Rahmen der sogenannten Liquid Biopsy eingesetzt. Dabei werden Tumorfragmente im Blut analysiert, um Rückfälle frühzeitig zu erkennen oder den Therapieerfolg zu überwachen. Diese Anwendungen zeigen, dass PCR längst nicht mehr nur eine Methode der Mikrobiologie ist, sondern auch zur personalisierten Krebstherapie beiträgt.
Zur Quantifizierung in der Onkologie empfehlen wir unseren Blog-Artikel qPCR in Klinik und Praxis: Quantifizierung für gezielte Therapien.
Die hohe Sensitivität der Polymerase-Kettenreaktion ist Fluch und Segen zugleich. Schon kleinste Kontaminationen können falsch-positive Ergebnisse erzeugen. Deshalb ist ein strenges Qualitätsmanagement unverzichtbar.
In Deutschland regelt die RiliBÄK (Richtlinie der Bundesärztekammer) die Qualitätssicherung. Dazu gehören interne Kontrollen mit Positiv- und Negativproben sowie externe Ringversuche, bei denen Labore ihre Ergebnisse mit Referenzproben vergleichen. International ist die ISO 15189 ein wichtiger Standard, der medizinische Laboratorien zertifiziert.
Auch für die Anwendung außerhalb klassischer Labore, also im Bereich des Point-of-Care-Testing (POCT), gelten strenge Regeln. Hier ist entscheidend, dass die Qualitätssicherung nicht leidet, auch wenn die Tests direkt in der Notaufnahme oder Praxis durchgeführt werden.
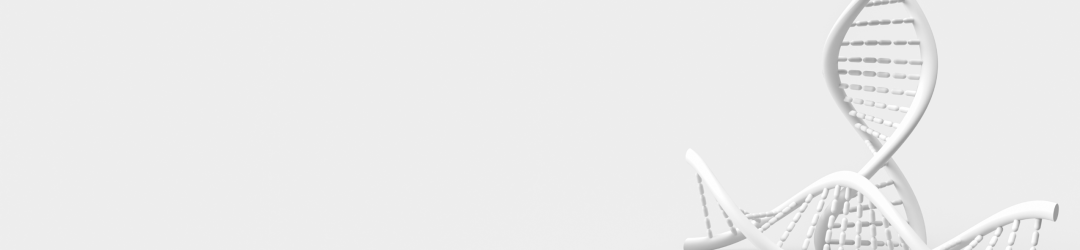
Die PCR ist nur dann wirklich wertvoll, wenn die Ergebnisse nahtlos in die Patientenversorgung einfließen. Deshalb ist die IT-Anbindung ein zentraler Aspekt (Erasmus et al., 2021).
In Kliniken ist es Standard, dass PCR-Geräte über Schnittstellen wie HL7 (Health Level Seven) oder FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources) mit dem Krankenhausinformationssystem verbunden sind. So gelangen Ergebnisse direkt in die elektronische Patientenakte.
Auch in Praxen wird die Integration in Laborinformationssysteme immer wichtiger. Moderne Geräte bieten oft zusätzlich Bluetooth- oder WLAN-Schnittstellen. Die Zukunft liegt in Middleware-Systemen, die verschiedene Geräte miteinander verknüpfen und Daten standardisiert bereitstellen. Welche Kriterien bei der Auswahl eines passenden Systems entscheidend sind, lesen Sie in unserem Blog-Artikel PCR-Testgerät auswählen: Leitfaden für Klinik und Praxis.
Die Polymerase-Kettenreaktion ist eine relativ teure Methode. Die Kosten entstehen durch die Geräte, die Reagenzien und das geschulte Personal.
Ein Überblick verdeutlicht die Unterschiede:
| Einrichtung | Vergütung | Besonderheiten |
|---|---|---|
| Klinik | DRG-System (Diagnosis Related Groups) | PCR kann indirekt Kosten sparen, z. B. durch kürzere Liegezeiten oder Vermeidung von Isolierungen |
| Praxis | EBM (Einheitlicher Bewertungsmaßstab) | Abrechnungsmöglichkeiten oft begrenzt, Tests manchmal nicht kostendeckend |
Für Kliniken lohnt sich PCR häufig dadurch, dass sie Folgeinfektionen verhindert und die gezielte Therapie ermöglicht. In Praxen ist der Einsatz schwieriger, da die Vergütung oft unter den tatsächlichen Kosten liegt. Dennoch kann sich PCR lohnen, wenn sie Patient:innen schnelle Ergebnisse und eine gezielte Behandlung ermöglicht.
Auch wenn die Polymerase-Kettenreaktion der Goldstandard ist, gibt es alternative Methoden wie Antigen- oder Antikörpertests. Ein Vergleich zeigt ihre jeweiligen Stärken und Schwächen:
| Methode | Sensitivität | Spezifität | Geschwindigkeit | Typisches Einsatzgebiet |
|---|---|---|---|---|
| PCR | Sehr hoch | Sehr hoch | Stunden | Infektionsdiagnostik, Onkologie |
| Antigen-Test | Niedriger | Mittel | Minuten | Schnelltests, Screening |
| Antikörper-Test | Mittel | Hoch | Stunden bis Tage | Serologie, Immunstatus |
Dieser Vergleich macht deutlich: Antigen-Tests sind vor allem für Screening-Situationen geeignet, während PCR die zuverlässigste Methode für die endgültige Diagnose bleibt. Wie sich mit einem einzigen Test mehrere Erreger erfassen lassen, beschreibt unser Blog-Artikel Multiplex PCR: Viele Antworten in einem Test.
Die Polymerase Chain Reaction wird sich in den kommenden Jahren weiterentwickeln. Kompakte Point-of-Care-Geräte erlauben bereits heute eine Diagnostik direkt in der Praxis oder Notaufnahme. So beschreibt Xie et al. (2025), wie eine Open-Source-POC-PCR-Plattform eine Sensitivität von nahezu 100 % bei Zielviren erreicht – eine Blaupause für die Zukunft.
Künstliche Intelligenz könnte die Auswertung beschleunigen und dabei helfen, komplexe Muster zu erkennen. Auch Nachhaltigkeit spielt eine Rolle: Hersteller arbeiten daran, den Verbrauch von Plastik und Reagenzien zu reduzieren. Zudem wird die PCR zunehmend mit anderen Methoden kombiniert, etwa mit Sequenzierverfahren, die nicht nur das Vorhandensein eines Erregers, sondern auch seine genetische Vielfalt erfassen.
Ein spannendes Feld ist die Raumfahrtmedizin: bereits auf der Internationalen Raumstation wurde der Nachweis von DNA erfolgreich mittels PCR in Mikrogravitation durchgeführt, ohne Anpassung der Geräte oder Reagenzien (Boguraev et al., 2017).
Die Polymerase-Kettenreaktion (PCR) hat die Medizin revolutioniert und ist heute unverzichtbar. Sie ermöglicht den sicheren Nachweis von Viren, Bakterien, sexuell übertragbaren Infektionen und Tumormarkern. Für Kliniken und Praxen stellt sie eine Investition dar, die sich durch bessere Therapieentscheidungen und Patientenergebnisse lohnt. Trotz neuer Entwicklungen bleibt die PCR der Goldstandard, wird jedoch zunehmend durch isothermale Verfahren und digitale Lösungen ergänzt.
PCR steht für Polymerase-Kettenreaktion und vervielfältigt DNA oder RNA, sodass kleinste Mengen zuverlässig nachgewiesen werden können.
PCR wird eingesetzt bei viralen Infektionen wie SARS-CoV-2, HIV oder Hepatitis, bei bakteriellen Infektionen wie Tuberkulose oder MRSA, bei sexuell übertragbaren Krankheiten wie Chlamydien oder HPV sowie in der Onkologie zur Mutationsanalyse.
PCR benötigt Temperaturzyklen und spezielle Geräte, während isothermale Verfahren wie LAMP bei konstanter Temperatur schneller und einfacher funktionieren, aber weniger etabliert sind.
In Kliniken ja, da sie Folgekosten reduziert. In Praxen ist die Abrechnung oft schwierig, dennoch kann sich PCR lohnen, wenn schnelle Entscheidungen erforderlich sind.
PCR wird durch Miniaturisierung, digitale Integration und nachhaltigere Reagenzien weiter an Bedeutung gewinnen und bleibt auf absehbare Zeit die wichtigste molekulare Diagnostikmethode.
Die bereitgestellten Informationen sind ausschließlich für medizinisches Fachpersonal bestimmt. Sie dienen der neutralen, unabhängigen Information über Produkte und Studien im Bereich der In-vitro-Diagnostik. Eine individuelle Beratung oder Empfehlung erfolgt nicht. Alle Inhalte werden sorgfältig geprüft, dennoch übernehmen wir keine Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Die Nutzung erfolgt auf eigenes Risiko, jegliche Haftung ist ausgeschlossen.