Diagnoodle Blog Home > Polymerase Chain Reaction (PCR) > PCR-Testverfahren
Das PCR-Testverfahren, die Polymerase-Kettenreaktion, ist seit Jahrzehnten unverzichtbar in der Medizin. Spätestens durch die SARS-CoV-2-Pandemie wurde es weltweit bekannt. Für Ärztinnen und Ärzte, sowie für den Klinikeinkauf ist entscheidend zu verstehen, welche Varianten existieren, wie sie sich unterscheiden und welche Konsequenzen sich für Diagnostik und Therapie ergeben. Einen übergeordneten Überblick finden Sie in unserem Blog-Artikel PCR in der modernen Medizin.
Die Polymerase-Kettenreaktion vervielfältigt kleinste Mengen an Erbmaterial wie Desoxyribonukleinsäure (DNA) oder Ribonukleinsäure (RNA), bis sie zuverlässig messbar sind. Dies geschieht in wiederholten Zyklen: Zunächst werden die Doppelstränge der DNA getrennt, anschließend lagern sich kurze DNA-Stücke, sogenannte Primer, an. Ein Enzym, die DNA-Polymerase, verlängert die Stränge und erzeugt Kopien. Nach wenigen Dutzend Zyklen stehen Millionen Kopien der Zielsequenz zur Verfügung.
Das Verfahren ist so sensitiv, dass selbst Spuren eines Virus oder einer Mutation nachgewiesen werden können. Genau diese Präzision macht PCR zum Referenzstandard in Infektionsmedizin, Onkologie und zunehmend auch in der personalisierten Medizin. Wie die Echtzeitmessung funktioniert, erläutern wir im Blog-Artikel PCR Real-Time: Echtzeitdiagnostik für Klinik und Praxis.
| Verfahren | RNA Nachweis | Quantifizierung möglich | Mehrere Erreger gleichzeitig | Kosten pro Test |
|---|---|---|---|---|
| RT PCR (Reverse Transkriptase PCR) | ✓ | ✗ | ✗ | Mittel |
| qPCR (quantitative PCR) | ✓ | ✓ | ✗ | Mittel bis hoch |
| Multiplex PCR | ✓ | ✗ | ✓ | Hoch |
| Digitale PCR | ✓ | ✓ | ✗ | Sehr hoch |
Die Reverse-Transkriptase-PCR (RT-PCR) wird eingesetzt, wenn ein Erreger RNA als genetisches Material besitzt. Die RNA wird zunächst durch ein Enzym in DNA umgeschrieben und anschließend vervielfältigt. Damit lassen sich Infektionen sehr früh erkennen, oft bevor Antikörpertests reagieren. In einer aktuellen Evaluierung zeigten 12 HIV-1-Viruslast-Tests, darunter RT-PCR-Assays, eine hohe Präzision und gute Übereinstimmung mit Referenzmethoden (Wang et al., 2025).
Die quantitative PCR (qPCR) misst während der Vervielfältigung die Menge des entstehenden Produkts, sodass nicht nur ein Nachweis, sondern auch eine exakte Kopienzahl ermittelt werden kann. In einer aktuellen Studie validierten Fofana et al. (2024) einen multiplexen qPCR-Assay zur gleichzeitigen Quantifizierung von HIV und HBV, der in seiner Quantitätsgenauigkeit mit etablierten Referenztests vergleichbar war. Mehr zur frühen Diagnostik und sicheren Steuerung der Therapie erfahren Sie im Blog-Artikel HIV-PCR-Test: Früh erkennen & Therapie sicher steuern.
In der HIV- und Hepatitistherapie ist die qPCR unersetzlich. Ein Anstieg der Viruslast zeigt, dass die aktuelle Medikation nicht mehr ausreicht. Sinkt die Viruslast unter die Nachweisgrenze, gilt die Therapie als erfolgreich. In der Onkologie ermöglicht die qPCR, Mutationen in Tumorzellen genau zu quantifizieren und die Wirksamkeit einer Behandlung engmaschig zu überwachen. Zur Quantifizierung in der PCR-Diagnostik empfehlen wir unseren Blog-Artikel qPCR in Klinik und Praxis: Quantifizierung für gezielte Therapien.
Die Multiplex-PCR erlaubt es, mehrere Zielsequenzen parallel in einem einzigen Reaktionsansatz nachzuweisen. Dies ist vor allem in der Diagnostik sexuell übertragbarer Infektionen wie Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae oder Mycoplasma genitalium von Vorteil. Eine Probe reicht aus, um mehrere Erreger gleichzeitig zu erkennen. Wie sich mit einem einzigen Test mehrere Erreger erfassen lassen, beschreibt unser Blog-Artikel Multiplex PCR: Viele Antworten in einem Test.
Auch in der Pneumonie-Diagnostik hat sich diese Methode etabliert. Statt Erreger nacheinander zu prüfen, liefert die Multiplex-PCR ein umfassendes Bild. Das ermöglicht eine gezielte und schnelle Antibiotikatherapie und verhindert sowohl Unter- als auch Überbehandlung. Studien zeigen, dass dadurch Krankenhausaufenthalte verkürzt und Resistenzentwicklungen reduziert werden (Aguilera-Franco et al., 2024).
Die digitale PCR (dPCR) geht noch einen Schritt weiter. Die Probe wird in viele winzige Reaktionskammern aufgeteilt, sodass jede Kammer nur eine DNA- oder RNA-Kopie enthält. Am Ende wird gezählt, wie viele Kammern positiv sind. Dadurch entsteht eine absolute und hochpräzise Quantifizierung.
Vor allem in der Onkologie ist dieses Verfahren wegweisend. Bei der sogenannten Liquid Biopsy können Tumorfragmente aus dem Blut analysiert werden, ohne dass eine invasive Biopsie nötig ist. So lassen sich Rückfälle frühzeitig erkennen oder Therapien individuell anpassen. Ein typisches Beispiel ist die EGFR-Mutation beim Lungenkarzinom, die den Einsatz spezieller Tyrosinkinase-Inhibitoren ermöglicht (Rathor et al., 2024).
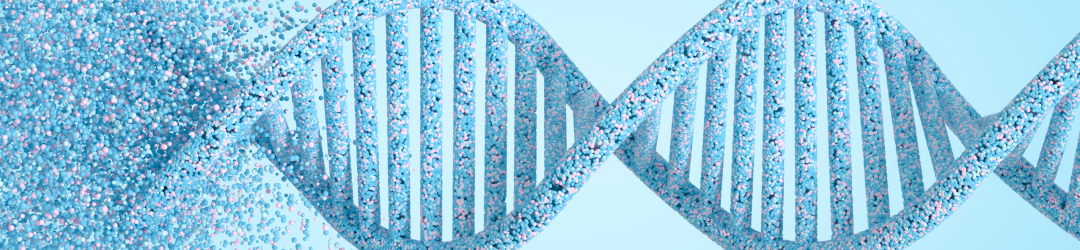
PCR-Testverfahren können entweder im Zentrallabor oder direkt am Ort der Patientenversorgung, dem sogenannten Point of Care, durchgeführt werden.
Im Labor stehen Standardisierung und Skalierbarkeit im Vordergrund. Viele Proben können in kurzer Zeit und hoher Qualität bearbeitet werden. Ergebnisse liegen meist nach zwölf bis vierundzwanzig Stunden vor, was für Routine und Screening ideal ist. In unserem Blog-Artikel PCR-Test im Überblick: Varianten, Zuverlässigkeit, Konsequenzen erfahren Sie mehr über die praktischen Einsatzmöglichkeiten in Klinik und Praxis.
Point-of-Care-Systeme sind kompakter und liefern Ergebnisse in dreißig bis neunzig Minuten. Sie sind in Notaufnahmen und Praxen unverzichtbar, wenn schnelle Entscheidungen getroffen werden müssen. Ob Isolation bei einem Methicillin-resistenten Staphylococcus aureus oder antivirale Therapie bei Influenza: Die unmittelbare Verfügbarkeit des Ergebnisses kann den Therapieverlauf entscheidend beeinflussen (Li et al., 2024). Welche Kriterien bei der Auswahl eines passenden Systems entscheidend sind, lesen Sie in unserem Blog-Artikel PCR-Testgerät auswählen: Leitfaden für Klinik und Praxis.
Die Sensitivität der PCR macht strenge Qualitätskontrollen notwendig. Schon kleinste Kontaminationen können falsche Ergebnisse verursachen. In Deutschland regelt die Richtlinie der Bundesärztekammer (RiliBÄK) die Qualitätssicherung, international ist die Norm ISO 15189 maßgeblich (Liu et al., 2024).
Wirtschaftlich sind PCR-Verfahren aufwendig, amortisieren sich jedoch durch verkürzte Liegezeiten, weniger Fehlbehandlungen und höhere Patientensicherheit. In Kliniken werden die Kosten über das DRG-System (Diagnosis Related Groups) abgebildet. Praxen rechnen über den Einheitlichen Bewertungsmaßstab (EBM) ab, was die tatsächlichen Kosten oft nicht deckt. Dennoch bieten PCR-Verfahren einen Mehrwert durch schnellere Entscheidungen und höhere Patientenzufriedenheit (Davies et al., 2024).
Die Zukunft liegt in miniaturisierten Geräten, die sich nahtlos in digitale Systeme integrieren lassen. Schnittstellen wie Health Level Seven (HL7) und Fast Healthcare Interoperability Resources (FHIR) verbinden Ergebnisse direkt mit elektronischen Patientenakten (Erasmus et al., 2021). Künstliche Intelligenz wird zunehmend eingesetzt, um Muster schneller zu erkennen und Auswertungen zu beschleunigen. Nachhaltigkeit, etwa durch reduzierte Verbrauchsmaterialien, rückt ebenfalls stärker in den Fokus.
PCR-Testverfahren sind Goldstandard der modernen Diagnostik und unverzichtbar für präzise Therapien. Ob Viruslastkontrolle bei HIV, Resistenznachweis bei Tuberkulose oder Mutationsanalyse in der Onkologie – die Ergebnisse entscheiden über Isolation, Medikamentenwahl und Verlaufsbeurteilung. Laborverfahren und Point-of-Care-Systeme ergänzen sich dabei und bieten Sicherheit sowohl im klinischen Alltag als auch in der niedergelassenen Praxis. Mit digitalen Lösungen und KI-gestützten Auswertungen wird die PCR auch in Zukunft ein zentrales Instrument bleiben.
PCR-Testverfahren gelten als Goldstandard, da sie selbst geringe Mengen an Erbmaterial sicher nachweisen können. Im Vergleich zu Antigen- oder Antikörpertests liefern sie eine deutlich höhere Sensitivität und Spezifität.
Die Dauer hängt davon ab, ob die Analyse im Labor oder am Point of Care erfolgt. Im Labor beträgt die Zeit in der Regel zwölf bis vierundzwanzig Stunden, während Point-of-Care-Systeme Ergebnisse oft schon nach dreißig bis neunzig Minuten liefern.
PCR-Testverfahren werden unter anderem zur Diagnostik von Virusinfektionen wie Influenza, HIV, Hepatitis oder SARS-CoV-2 eingesetzt. Auch bakterielle Erreger und bestimmte Tumormutationen lassen sich präzise nachweisen.
Die Ergebnisse steuern direkte Behandlungsentscheidungen. Sie können den Beginn antiviraler Therapien, die Wahl eines Antibiotikums oder den Einsatz zielgerichteter Krebstherapien bestimmen.
Die Kosten pro Test variieren je nach Verfahren und System. Klassische Labor-PCR ist pro Probe günstiger, während Point-of-Care- und digitale PCR-Verfahren höhere Kosten verursachen. Kliniken profitieren jedoch von verkürzten Liegezeiten und vermiedenen Fehlbehandlungen, wodurch sich die Investition amortisieren kann.
Die bereitgestellten Informationen sind ausschließlich für medizinisches Fachpersonal bestimmt. Sie dienen der neutralen, unabhängigen Information über Produkte und Studien im Bereich der In-vitro-Diagnostik. Eine individuelle Beratung oder Empfehlung erfolgt nicht. Alle Inhalte werden sorgfältig geprüft, dennoch übernehmen wir keine Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Die Nutzung erfolgt auf eigenes Risiko, jegliche Haftung ist ausgeschlossen.