Diagnoodle Blog Home > Blutbild > Hauptartikel
Hinweis: Dieser Artikel richtet sich ausschließlich an medizinische Fachkreise.
Das Blutbild zählt zu den am häufigsten eingesetzten Laboruntersuchungen. Es ist kostengünstig, rasch durchführbar und liefert gleichzeitig eine Fülle an klinisch relevanten Informationen. Für Ärztinnen und Ärzte stellt es oft den ersten diagnostischen Schritt dar, sei es bei banalen Infekten oder bei komplexen hämatologischen Erkrankungen.
Mit der wachsenden Verfügbarkeit von Point of Care Testing (POCT) verändert sich die Rolle dieser Untersuchung. Mussten Proben früher ins Zentrallabor geschickt werden, stehen heute Systeme zur Verfügung, die innerhalb weniger Minuten direkt am Patientenbett Ergebnisse liefern. Das verkürzt Entscheidungswege erheblich und kann im Notfall lebensrettend sein.
Dieser Artikel gibt einen umfassenden Überblick: Er beschreibt, was ein Blutbild ist, erläutert die Unterschiede zwischen kleinem und großem Blutbild, zeigt die Relevanz der Kombination mit CRP, geht auf präanalytische Herausforderungen, Reflexkriterien und Referenzintervalle ein, erklärt Messmethoden am Point of Care, beleuchtet Fragen des Qualitätsmanagements, der IT-Anbindung sowie ökonomische und regulatorische Aspekte und wagt einen Ausblick auf den Einsatz von Künstlicher Intelligenz.
Unter einem Blutbild versteht man die quantitative und qualitative Analyse der Blutzellen. Im Mittelpunkt stehen drei Zelllinien: Die Erythrozyten sind für den Sauerstofftransport zuständig, die Leukozyten bilden die Basis der Immunabwehr, und die Thrombozyten sichern die Blutgerinnung. Ergänzt werden diese Basiswerte durch abgeleitete Parameter wie Hämoglobin, Hämatokrit oder die Erythrozytenindizes. Besonders wichtig ist hier das mittlere Zellvolumen (MCV), da es bei der Klassifikation von Anämien eine Schlüsselrolle spielt.
Die Stärke des Blutbilds liegt darin, eine Vielzahl an Erkrankungen zumindest andeuten oder ausschließen zu können. So weist eine mikrozytäre Anämie typischerweise auf Eisenmangel hin, eine Leukozytose spricht für eine Infektion, und eine Thrombozytopenie kann Störungen der Blutgerinnung anzeigen.
Das kleine Blutbild umfasst die wesentlichen Basisparameter wie Erythrozyten, Leukozyten, Thrombozyten, Hämoglobin, Hämatokrit und die Erythrozytenindizes. Für viele Routineuntersuchungen wie Vorsorge, Verlaufskontrollen oder Screening ist es ausreichend.
Das große Blutbild ergänzt diese Angaben um die Differenzierung der Leukozyten. Abhängig von der eingesetzten Technik lassen sich entweder drei, fünf oder sogar sechs Untergruppen darstellen. Während die grobe Einteilung in Granulozyten, Lymphozyten und Monozyten (3-diff) für viele Fragestellungen genügt, liefert die 5-diff-Analyse eine detaillierte Aufschlüsselung aller Hauptpopulationen. Systeme mit 6-diff ermöglichen zusätzlich die Erfassung unreifer oder atypischer Zellen. Das große Blutbild ist insbesondere bei unklaren Infektionen, hämatologischen Erkrankungen oder in der Onkologie unverzichtbar.
Lesen Sie mehr zum Thema in den Artikeln „Kleines Blutbild Werte“ und „Großes Blutbild Werte“.
Das C-reaktive Protein (CRP) ist ein Akutphaseprotein, das insbesondere bei bakteriellen Infektionen stark ansteigt. Wird es mit dem Blutbild kombiniert, ergibt sich ein zweidimensionales Bild: Die Leukozytenzahl und das Differenzialblutbild geben Auskunft über die zelluläre Antwort, während CRP die Dynamik der Entzündung abbildet.
In der Notaufnahme hilft diese Kombination dabei, schnell über die Notwendigkeit einer Antibiotikatherapie zu entscheiden. Auch in der Pädiatrie ist sie hilfreich, weil invasive Diagnostik bei Kindern möglichst vermieden wird. Mehrere aktuelle Studien belegen die diagnostische Genauigkeit kombinierter Systeme, die Blutbild und CRP innerhalb weniger Minuten bestimmen und dabei eine hohe Übereinstimmung mit Laborreferenzen zeigen (Nencini et al., 2024; Goyal et al., 2024; Kuniyoshi et al., 2024).
Die Präanalytik ist einer der wichtigsten Faktoren für die Qualität eines Blutbilds. Fehler in dieser Phase können selbst durch die beste Analytik nicht korrigiert werden. Venöses Blut gilt als stabiler, während kapillares Blut für den Einsatz am Point of Care praktischer ist, jedoch leicht verfälscht werden kann, wenn die Entnahme unsachgemäß erfolgt. EDTA ist das Standard-Antikoagulans, doch führt eine Über- oder Unterdosierung zu falsch interpretierten Werten. Auch lange Transportzeiten können Artefakte verursachen, und Störfaktoren wie Hämolyse, Lipämie oder Ikterus beeinflussen bestimmte Messverfahren.
Gerade im POCT-Bereich, wo häufig Personal ohne laboranalytische Ausbildung die Proben entnimmt, sind strukturierte Schulungen, klare Standard Operating Procedures (SOPs) und Geräte mit Fehlertoleranz unverzichtbar.
Automatisierte Analysatoren liefern präzise Ergebnisse, stoßen jedoch bei bestimmten Befunden an ihre Grenzen. Deshalb sind Reflexkriterien etabliert, die eine mikroskopische Kontrolle notwendig machen. Dazu gehören etwa Flags für Blasten oder unreife Granulozyten, auffällige Indizes bei Anämien oder Delta-Checks im Vergleich zu Vorwerten. Auch die Abklärung einer Thrombozytopenie erfordert häufig den mikroskopischen Nachweis, um eine EDTA-induzierte Pseudothrombozytopenie auszuschließen.
Die mikroskopische Differenzierung des Blutausstrichs bleibt somit unverzichtbar. Sie macht morphologische Auffälligkeiten sichtbar, die durch automatisierte Systeme oft nur angedeutet werden (Kim et al., 2025; Panozzo et al., 2025).
Ein Blutbild ist nur im Abgleich mit Referenzintervallen interpretierbar. Diese hängen von Alter, Geschlecht, ethnischem Hintergrund und sogar von der Höhenlage des Wohnorts ab. Besonders in der Pädiatrie unterscheiden sich Referenzwerte deutlich vom Erwachsenenalter.
Darüber hinaus muss die biologische Variation berücksichtigt werden. Manche Parameter schwanken natürlicherweise, während andere sehr stabil bleiben. Studien zeigen, dass viele Blutbild-Parameter bei einer Person einen typischen individuellen Ausgangswert haben, der die personalisierte Interpretation erleichtert. Abweichungen von diesem persönlichen Muster können dadurch zuverlässiger erkannt und bewertet werden (Foy et al., 2025; Go et al., 2025).
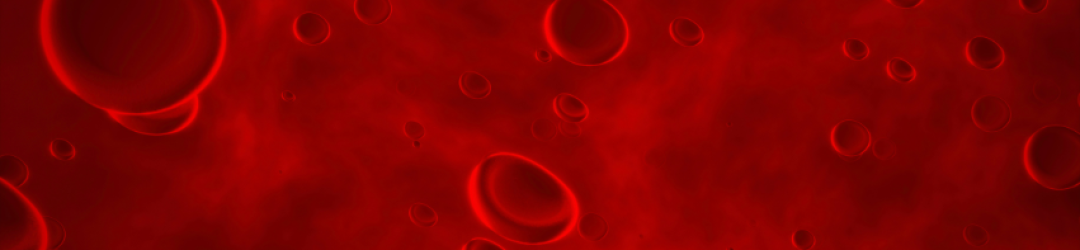
Am Point of Care sind Geräte gefragt, die robust, schnell und leicht bedienbar sind. Dafür kommen verschiedene Technologien in Frage. Die Impedanzmessung ist kostengünstig und zuverlässig, ermöglicht jedoch nur eine eingeschränkte Differenzierung. Die optische Durchflusszytometrie bietet eine detaillierte Analyse bis hin zu 5- oder 6-diff, ist allerdings teurer und komplexer in der Handhabung. Fluoreszenzmethoden erlauben die Erkennung unreifer oder atypischer Zellen, und Kombinationssysteme verbinden die Vorteile von Impedanz und Optik.
Welche Technologie gewählt wird, hängt von den klinischen Anforderungen ab. Moderne Übersichtsarbeiten beschreiben die Leistungsfähigkeit dieser Systeme und weisen auf typische Fehlerquellen hin, die bei der Auswahl berücksichtigt werden sollten (Shean et al., 2024; Daves et al., 2024).
Geräte, die außerhalb klassischer Labore betrieben werden, erfordern ein besonders konsequentes Qualitätsmanagement. Dazu gehören interne Kontrollen, die täglich durchgeführt und dokumentiert werden, sowie externe Ringversuche, die den Vergleich mit dem Zentrallabor sicherstellen. Ebenso wichtig ist die klare Zuweisung der Verantwortlichkeiten – in Kliniken häufig an eine ärztliche Leitung oder spezielle POCT-Koordinatoren, in Praxen in der Regel direkt an die behandelnden Ärztinnen und Ärzte. Nur mit einem sauberen Qualitätsmanagement lassen sich rechtliche Vorgaben erfüllen und Fehlinterpretationen vermeiden.
Die Integration in klinische Informationssysteme entscheidet wesentlich über den Erfolg von POCT. Schnittstellen wie HL7, POCT1-A oder FHIR sind dabei zentral. Eine Middleware erlaubt die zentrale Steuerung von Geräten, Qualitätssicherung und Benutzerverwaltung. Auch die Patientensicherheit profitiert: Automatische Identifikationen verhindern Medienbrüche und reduzieren Fehler. Fehlt die IT-Anbindung, entstehen doppelte Dokumentationsaufwände, höhere Risiken und ineffiziente Prozesse.
Blutbildgeräte am Point of Care sind in vielen klinischen und ambulanten Settings sinnvoll. In der Notaufnahme ermöglichen sie eine schnelle Triage bei Infekten, Blutungen oder Anämien. Auf der Intensivstation dienen sie dem Monitoring von Patientinnen und Patienten mit Sepsis oder unter Chemotherapie. Auch im OP oder im perioperativen Bereich sichern sie eine rasche Kontrolle bei Blutverlust. In der Pädiatrie wiederum bieten sie den Vorteil kleiner Probenvolumina.
Darüber hinaus erleichtern Blutbildgeräte in Hausarztpraxen oder Pflegeheimen schnelle Entscheidungen und vermeiden Transporte. Selbst im häuslichen Umfeld sind Messungen des kleinen Blutbilds für onkologische Patientinnen und Patienten inzwischen denkbar und können die Lebensqualität verbessern (Friis Hansen et al., 2024).
Ob ein Blutbild im Zentrallabor oder direkt am Patienten durchgeführt wird, ist eine grundlegende Frage des klinischen Workflows. Das Zentrallabor bietet höchste Präzision, eine große Parametervielfalt, standardisierte Qualität und niedrige Kosten pro Test bei hohem Volumen. Allerdings sind die Ergebnisse durch Transportwege und Logistik zeitverzögert. Das Point of Care Testing dagegen liefert Resultate innerhalb weniger Minuten und unterstützt klinische Entscheidungen unmittelbar, allerdings bei geringerer Parametervielfalt, höheren Kosten pro Test und erhöhtem Aufwand für Schulung und Qualitätssicherung. Viele Einrichtungen kombinieren beide Ansätze, wobei das Zentrallabor die Basis bildet und POCT zeitkritische Situationen abdeckt (Shean et al., 2024).
Die Anschaffungskosten von Point-of-Care-Blutbildgeräten variieren je nach Ausstattung deutlich. Nach den auf Diagnoodle verfügbaren Informationen beginnen einfache Systeme bei etwa 8.000 Euro. Geräte mit erweitertem Differenzial oder zusätzlichen Funktionen bewegen sich im Bereich von 15.000 bis rund 25.000 Euro. Wichtig ist, die laufenden Kosten für Reagenzien, Qualitätskontrollen und Service in die Kalkulation einzubeziehen. Leasingmodelle oder Pay-per-Test-Konzepte können die Einstiegskosten zusätzlich reduzieren.
Die Abrechnung hängt vom jeweiligen Gesundheitssystem ab. In Deutschland gilt: Im ambulanten Bereich erfolgt sie für gesetzlich Versicherte über den EBM, für Privatpatienten über die GOÄ. Kleines und großes Blutbild haben jeweils eigene Ziffern. Stationär werden Kosten über DRGs abgegolten.
Bei POCT ist die Situation komplexer: Hier stehen höheren Stückkosten, Geräteinvestitionen und Qualitätssicherungsaufwand Vorteile wie kürzere Aufenthalte und schnellere Diagnostik gegenüber. Wirtschaftlich lohnt sich POCT vor allem dann, wenn dadurch Prozesskosten gesenkt und klinische Ergebnisse verbessert werden.
| Bereich | EBM Code | EBM-Vergütung | GOÄ Code | GOÄ-Vergütung | IGeL | Stationär (DRG) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kleines Blutbild | 32120 | Wenige Euro je nach KV-Region | 3550 | Ca. 4 € je nach Faktor | Praxisindividuell, oft niedriger zweistelliger Betrag, meist im Paket | Im DRG-Fallpauschalensystem enthalten |
| Großes Blutbild | 32122 | Wenige Euro je nach KV-Region | 3550 + 3551 | Ca. 5–6 € je nach Faktor | Mittlerer zweistelliger Betrag und mehr, abhängig von Zusatzleistungen | Im DRG-Fallpauschalensystem enthalten |
Hinweis: EBM (Einheitlicher Bewertungsmaßstab) ist das Abrechnungssystem für gesetzlich Versicherte. GOÄ (Gebührenordnung für Ärztinnen und Ärzte) gilt für Privatpatientinnen und -patienten und richtet sich nach festgelegten Ziffern mit Steigerungsfaktor. IGeL (Individuelle Gesundheitsleistungen) sind Zusatzleistungen, die Patientinnen und Patienten selbst zahlen. DRG (Diagnosis Related Groups) ist das Fallpauschalensystem im stationären Bereich.
Für Blutbildgeräte gelten strenge regulatorische Vorgaben. In Deutschland schreibt die Richtlinie der Bundesärztekammer zur Qualitätssicherung laboratoriumsmedizinischer Untersuchungen (RiliBÄK) die interne und externe Qualitätssicherung sowie klare Verantwortlichkeiten vor. Die Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) in den USA setzt internationale Standards zu Präanalytik und Gerätevalidierung, während International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (IFCC) und World Health Organization (WHO) harmonisierte Referenzintervalle bereitstellen. Auf europäischer Ebene definiert die IVDR die Anforderungen für In-vitro-Diagnostika, einschließlich Software und KI. Nur Geräte, die diese Standards erfüllen, dürfen eingesetzt werden.
Zunehmend wird Künstliche Intelligenz in Blutbildgeräte integriert. Sie unterstützt beispielsweise bei der automatischen Leukozytendifferenzierung, bei der Erkennung von Anomalien, in der Qualitätssicherung oder bei der Datenintegration mit Vitalparametern. Der Nutzen liegt in schnelleren Befunden, einer Standardisierung der Diagnostik und in der Entlastung des Personals. Risiken bestehen in möglichen Bias durch unzureichende Trainingsdaten, intransparente Algorithmen und Datenschutzproblemen. Nach IVDR gelten KI-Systeme als Medizinprodukte und müssen validiert, dokumentiert und überwacht werden (Pozdnyakova et al., 2024).
Das Blutbild bleibt ein unverzichtbares diagnostisches Instrument. Es liefert zentrale Hinweise für Diagnostik und Therapie und gewinnt durch POCT weiter an Bedeutung. Für Fachkreise ist entscheidend, dass neben technischen Aspekten auch Präanalytik, Qualitätssicherung, IT-Integration, ökonomische Faktoren und regulatorische Anforderungen berücksichtigt werden. Mit dem Einsatz von KI eröffnen sich neue Möglichkeiten, die jedoch nur unter klaren Qualitäts- und Sicherheitsstandards sinnvoll nutzbar sind.
Es enthält Erythrozyten, Leukozyten, Thrombozyten, Hämoglobin, Hämatokrit und Erythrozytenindizes.
Immer dann, wenn Infektionen unklar sind, hämatologische Erkrankungen vermutet werden oder onkologische Fragestellungen vorliegen.
Die Ergebnisse stehen innerhalb weniger Minuten zur Verfügung, was eine unmittelbare Entscheidungsunterstützung ermöglicht und logistische Aufwände reduziert.
Je nach Ausstattung liegen sie zwischen rund 10.000 Euro für einfache Praxisgeräte und mehr als 25.000 Euro für High-End-Systeme, zuzüglich laufender Verbrauchskosten.
In Deutschland gilt die RiliBÄK, international setzen CLSI, IFCC und WHO Standards, und auf europäischer Ebene greift die IVDR.
Die bereitgestellten Informationen sind ausschließlich für medizinisches Fachpersonal bestimmt. Sie dienen der neutralen, unabhängigen Information über Produkte und Studien im Bereich der In-vitro-Diagnostik. Eine individuelle Beratung oder Empfehlung erfolgt nicht. Alle Inhalte werden sorgfältig geprüft, dennoch übernehmen wir keine Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Die Nutzung erfolgt auf eigenes Risiko, jegliche Haftung ist ausgeschlossen.