Diagnoodle Blog Home > Blutbild > EDTA Blutbild
Wenn ein Blutbild angefordert wird, landet die Probe fast immer im EDTA-Röhrchen. Ethylen-Diamin-Tetraessigsäure (EDTA) verhindert die Gerinnung und ermöglicht zuverlässige Zellzählungen. Für die tägliche Routine klingt das banal, doch in der Praxis entstehen genau hier viele Fehler: falsche Füllmenge, fehlendes Mischen oder lange Lagerzeiten.
EDTA ist eine organische Säure mit vier Carboxylgruppen und zwei Stickstoffatomen. Diese Struktur macht es zu einem Chelatbildner, der mehrwertige Metallionen, vor allem Kalzium, bindet. Da Kalzium für die Gerinnung unverzichtbar ist, blockiert EDTA zuverlässig die Gerinnungskaskade.
Im Labor wird EDTA fast immer als Salz eingesetzt, meist Dinatrium-EDTA (Na₂EDTA) oder Dipotassium-EDTA (K₂EDTA). Sie sind wasserlöslich und stabilisieren Blutzellen über mehrere Stunden.
Doch EDTA ist nicht neutral:
– Unterfüllung → zu viel EDTA, Erythrozyten schrumpfen, MCV (mittleres Zellvolumen) sinkt fälschlich.
– Überfüllung → zu wenig EDTA, Teilgerinnung verfälscht Zellzahlen.
– Lagerung > 4 bis 6 Stunden → Leukozyten-Morphologie verändert sich, Differenzialblutbilder sind eingeschränkt verwertbar.
Für valide Ergebnisse für das große und kleine Blutbild braucht es also nicht nur das richtige Röhrchen, sondern auch korrekte Handhabung (Lippi et al., 2017). Erfahren Sie mehr Hintergründe zu Referenzwerten im großen und Referenzwerten im kleinen Blutbild.
Kapillarblut kommt vor allem bei Neugeborenen, Kindern oder instabilen Patient:innen zum Einsatz. In Kombination mit EDTA treten typische Probleme auf:
– Unsachgemäße Punktion führt zu Hämolyse.
– Luftblasen oder Gewebsflüssigkeit verfälschen Zellzahlen.
– Langsames Befüllen begünstigt Teilgerinnungen.
Venöses Blut ist stabiler, aber auch hier gilt: Reihenfolge der Röhrchen beachten. EDTA darf erst nach Serum- und Heparinröhrchen abgenommen werden. Sonst gelangen EDTA-Spuren in Serumproben und führen zu falsch-niedrigen Calcium- oder Magnesiumwerten und falsch-hohen Kaliumwerten (Clinical & Laboratory Standards Institute).
Präanalytik-Fehler lassen sich durch Stanadrd Operating Procedures (SOPs) und Schulung vermeiden, sonst gefährden sie Diagnostik und Therapie.
Eine bekannte EDTA-Falle ist die Pseudothrombozytopenie. Dabei verklumpen Thrombozyten im EDTA-Röhrchen. Analyzer werten die Aggregate nicht als Thrombozyten und melden fälschlich eine Thrombozytopenie.
Klinische Risiken: unnötige Abklärungen, Fehldiagnosen oder sogar Transfusionen. Um dies zu verhindern, sollten folgende Workflows etabliert sein:
– Delta Checks: Vergleich mit Vorwerten, auffällige Abweichungen prüfen.
– Mikroskopie: Ausstrich zeigt Thrombozytenaggregate.
– Zweitprobe: Bei Verdacht Untersuchung aus Citrat- oder Heparinblut wiederholen.
Labore können Reflexprüfungen hinterlegen, sodass pathologisch niedrige Thrombozytenwerte automatisch kontrolliert werden. Das spart Kosten und schützt Patient:innen (Bizzaro, 1995).
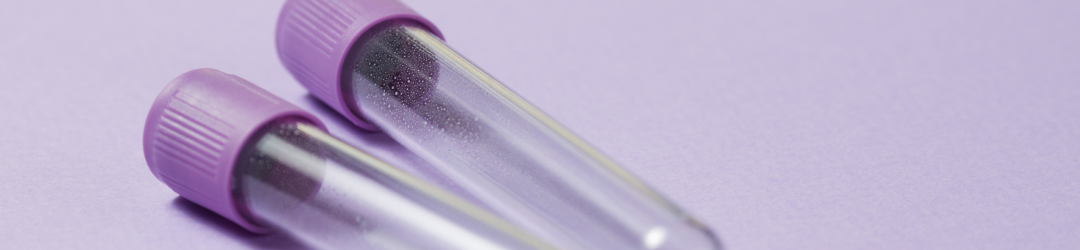
Auch im EDTA-Blutbild gilt die Pflicht zur Qualitätssicherung:
– IQC (Internal Quality Control): interne tägliche Kontrollen der Gerätefunktion.
– EQAS (External Quality Assessment Scheme): externe Ringversuche für Vergleichbarkeit.
Präanalytik muss ebenfalls dokumentiert sein: Füllmenge, Mischtechnik, Abnahmereihenfolge, Lagerzeiten. Eine korrekte Mischung bedeutet 3 bis 4 Mal sanftes Kippen – kein Schütteln, um Hämolyse zu vermeiden.
Kliniken profitieren von klaren Vorgaben. Wenn Abweichungen dokumentiert und analysiert werden, lassen sich Fehlerquellen gezielt abstellen laut Richtlinie der Bundesärztekammer zur Qualitätssicherung laboratoriumsmedizinischer Untersuchungen (Rili-BÄK).
Eine SOP für EDTA-Blutbilder sollte mindestens enthalten:
– Reihenfolge der Blutabnahme.
– Korrekte Füllmengen der Röhrchen.
– Mischtechnik nach der Entnahme.
– Maximal zulässige Lagerzeit bis zur Analyse.
– Vorgehen bei Artefakten (z. B. Verdacht auf Pseudothrombozytopenie).
Schulungen für Blutbild-Geräte sind unverzichtbar. Fallbeispiele aus der Praxis, wie z.B. ein Patient mit vermeintlicher Thrombozytopenie verdeutlichen, warum Präanalytik entscheidend ist. Wiederholungsschulungen sorgen dafür, dass sich Fehler nicht einschleifen. Neben der Präanalytik spielen auch wirtschaftliche Faktoren eine Rolle. Mehr dazu im Artikel “Großes Blutbild und Kosten in der Praxis/Klinik”.
Das EDTA Blutbild ist Standard, aber kein Selbstläufer. Schon kleine Fehler bei Füllmenge, Reihenfolge oder Lagerung führen zu Artefakten, die klinisch relevant sein können. Gesundheitsfachkräfte sollten EDTA nicht nur als Routine sehen, sondern als kritischen Punkt im Workflow. Wer Präanalytik ernst nimmt, reduziert Fehler, spart Kosten und schützt Patient:innen vor Fehldiagnosen. SOPs, Schulungen und Quick-Audits sind dabei die besten Werkzeuge.
Für ein Blutbild wird ein EDTA-Röhrchen eingesetzt, meist mit lila oder violettem Deckel. Es enthält Ethylen-Diamin-Tetraessigsäure (EDTA) als Antikoagulans. EDTA bindet Calcium und verhindert so die Blutgerinnung, wodurch eine zuverlässige Zellzählung möglich ist.
EDTA stabilisiert die Blutzellen und verhindert die Gerinnung. Ohne EDTA wären Differenzialblutbilder oder Leukozytenzählungen nicht möglich. Gleichzeitig muss die Füllmenge exakt eingehalten werden: Unterfüllung oder Überfüllung verfälschen Parameter wie MCV (mittleres Erythrozytenvolumen).
Typische Fehlerquellen sind: falsche Füllmenge des Röhrchens, fehlendes oder zu spätes Mischen, lange Lagerzeiten oder falsche Abnahmereihenfolge. Diese Fehler führen zu Artefakten wie Pseudothrombozytopenie oder unplausiblen Erythrozytenwerten.
Die EDTA-induzierte Pseudothrombozytopenie ist ein Präanalytik-Artefakt. Thrombozyten verklumpen im EDTA-Röhrchen, was Analyzer als zu niedrige Thrombozytenzahl anzeigen. Das kann zu Fehldiagnosen führen. Abhilfe schafft die Kontrolle im Blutausstrich oder die erneute Analyse in Citrat- oder Heparinblut.
Ein EDTA-Blutbild sollte innerhalb von 4 bis 6 Stunden analysiert werden. Bei längerer Lagerung verändern sich insbesondere Leukozytenmorphologie und Differenzialblutbilder. Für valide Ergebnisse gilt: zeitnahe Verarbeitung und korrekte Lagerbedingungen sind Pflicht.
Die bereitgestellten Informationen sind ausschließlich für medizinisches Fachpersonal bestimmt. Sie dienen der neutralen, unabhängigen Information über Produkte und Studien im Bereich der In-vitro-Diagnostik. Eine individuelle Beratung oder Empfehlung erfolgt nicht. Alle Inhalte werden sorgfältig geprüft, dennoch übernehmen wir keine Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Die Nutzung erfolgt auf eigenes Risiko, jegliche Haftung ist ausgeschlossen.